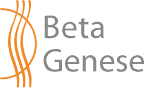Sportsucht: Der Zwang, zu trainieren
Sportsucht ist mehr als nur eine Leidenschaft für Sport – sie kann zu einem zwanghaften Verhalten werden, das den Alltag bestimmt. Schweißperlen glänzen auf der Stirn, die Muskeln brennen, das Herz rast – ein Bild des Triumphs, oder? Nicht immer. Betroffene von Sportsucht verspüren den unaufhaltsamen Drang, zu trainieren, selbst wenn sie erschöpft, verletzt oder krank sind. Sozialleben, Arbeit und Erholung rücken in den Hintergrund, denn der Sport bestimmt das Leben.
Doch wann wird intensives Training zur Sucht? Welche Symptome sind alarmierend? Und wie lässt sich ein gesunder Umgang mit Bewegung wiederherstellen? In diesem Artikel erklären wir alles Wichtige zu den Symptomen und Ursachen von Sportsucht als Zwangsstörung sowie Diagnose und Therapie von Sportsucht. In der BetaGenese Klinik helfen wir Betroffenen mit einem individuellen Therapieangebot, wieder ein gesundes Gleichgewicht zwischen Sport und Alltag zu finden.
Inhaltsverzeichnis
- Definition von Sportsucht
- Sportsucht: ICD-Klassifizierung
- Gefahren von Sportsucht
- Wo liegen die Grenzen zwischen Disziplin und Sportzwang
- Sportsucht als Verhaltenssucht
- Symptome von Sportsucht
- Ursachen und Risikofaktoren
- Sportzwang und Essstörungen
- 10 goldene Regeln, mit denen Sie eine Balance finden
- Psychische Folgen von Sportsucht
- Hilfe für Sportsüchtige in der BetaGenese Klinik

Jetzt Beratungsgespräch vereinbaren
Sportsucht: Das Wichtigste in Kürze
Was ist Sportsucht?
Sportsucht beschreibt den zwanghaften Drang, exzessiv zu trainieren – selbst bei Erschöpfung oder Verletzungen. Sport dominiert den Alltag, während soziale Kontakte, Arbeit und Erholung vernachlässigt werden.
Symptome einer Sportsucht
Betroffene von Sportsucht verspüren einen starken inneren Zwang zu trainieren – selbst bei Schmerzen, Erschöpfung oder Krankheit – und erleben Unruhe, Angst oder Schuldgefühle, wenn sie pausieren. Soziale Kontakte, Arbeit und andere Lebensbereiche werden zunehmend vernachlässigt, während die Trainingsintensität stetig gesteigert wird, um das gleiche Zufriedenheitsgefühl zu erreichen.
Ursachen und Risiken
Psychologische Faktoren wie Perfektionismus, hoher Leistungsdruck oder die Ausschüttung von Glückshormonen (Endorphine, Dopamin) verstärken die Sucht. Gesellschaftliche Ideale und Social Media beeinflussen zudem das ungesunde Verhältnis zu Sport.
Diagnose und Therapie
Obwohl Sportsucht nicht offiziell als psychische Erkrankung anerkannt ist, zeigt sie starke Parallelen zu anderen Verhaltenssüchten. In der BetaGenese Klinik bieten wir spezialisierte Therapieansätze, darunter kognitive Verhaltenstherapie und Biofeedback, um ein gesundes Gleichgewicht zwischen Bewegung und Alltag wiederherzustellen.
Definition von Sportsucht: Wie Sport zur Obsession werden kann
Sportsucht bedeutet, dass Sport nicht mehr nur Freude, Ausgleich oder ein gesundes Hobby ist, sondern zu einer unkontrollierbaren Notwendig wird, die den Alltag bestimmt.
Wer von Sportsucht betroffen ist, verspürt einen starken inneren Druck, zu trainieren – unabhängig von Schmerzen, Erschöpfung oder sozialen Verpflichtungen. Bewegung wird zur zentralen Priorität im Leben, während alles andere in den Hintergrund rückt. Obwohl Sportsucht keine offiziell anerkannte psychische Erkrankung ist, zeigen viele Betroffene deutliche Parallelen zu anderen Verhaltenssüchten wie der Spielsucht oder Kaufsucht, aber auch zu Essstörungen. Auch hier führt das Gefühl von Kontrollverlust dazu, dass das Verhalten trotz negativer Konsequenzen zwanghaft fortgesetzt wird.
Fallbeispiel: Vera Brück war süchtig nach Sport
Konnte Vera Brück nicht täglich zumindest einmal intensiv aktiv sein, wurde sie ungeduldig, reizbar und schwer erträglich. Sie versäumte die Hochzeit einer Freundin, weil sie unbedingt Sport treiben „musste“ und ließ aus demselben Grund auch schon einmal ein von ihrem Partner liebevoll vorbereitetes Gartenfest mit Gästen sausen. Nichts stand über dem Sport. „Ich musste immer an meine Grenzen gehen, völlig erschöpft sein“, berichtet die Rechtsanwältin. „Ich musste diese Endorphine spüren.“ Nur wenn sich diese flüchtigen Glücksgefühle beim Training einstellten, war der Tag für sie ein Erfolg, und sie war zufrieden mit sich selbst.
Jahrelang hielt Vera Brück an ihren Trainingsgewohnheiten fest. Tag für Tag besuchte sie entweder das Fitnessstudio, joggte oder radelte die Weinberge hoch. „Das war für mich ganz normal“, sagt sie. Erst als sie sich im Alter von 36 Jahren so schwer am Sprunggelenk verletzte, dass mehrere Operationen nötig waren und sie eine Weile zum Nichtstun verurteilt war, wurde ihr klar: „Ich bin süchtig nach Sport.“
Sportsucht: Trotz fehlender ICD-Klassifizierung ein ernstzunehmendes Problem
Trotz der Ähnlichkeiten zu einer Spielsucht ist die Anerkennung der Diagnose Sportsucht bisher nicht offiziell. Weder im internationalen Handbuch der Krankheitsklassifikation (ICD-11) noch im einflussreichen Diagnostischen und Statistischen Leitfaden für Psychische Störungen (DSM-5) der Amerikanischen Psychiatrischen Gesellschaft wird Sport- oder Bewegungssucht als eigenständige Erkrankung aufgeführt. Bisher ist nur die Spielsucht als offizielle Diagnose unter den Verhaltenssüchten anerkannt.
Die Forschung zur Sportsucht steckt noch in den Anfängen. Dies wird allein durch das Fehlen verlässlicher Zahlen darüber, wie viele Menschen betroffen sind, deutlich. Auch das Thema Übertraining im Zusammenhang mit Sportsucht ist noch gänzlich unerforscht. Unter Übertraining versteht man die physiologischen Auswirkungen, während Sportsucht die psychologische Komponente desselben Phänomens beschreibt.
Gefahren von Sportsucht: Gefangen im Fitnesswahn
Wer extrem viel Sport treibt, dabei Verletzungen ignoriert und seine sozialen Kontakte vernachlässigt, könnte tatsächlich unter einer Bewegungssucht leiden, vermutet Daniel Kosak, Sporttherapeut und stellvertretende Pflegeleitung der BetaGenese Klinik.

Sportsucht betrifft Personen, die zwanghaft Sport betreiben müssen, selbst wenn sie krank oder verletzt sind. Vor allem fällt auf: Betroffene verfolgen keine spezifischen sportlichen Ziele, sondern trainieren einfach um des Trainings willen. Dabei spielt es keine Rolle, wie viele Stunden jemand pro Woche trainiert. Ansonsten müssten die meisten Spitzensportler als süchtig eingestuft werden. Doch dem ist nicht so.
Daniel Kosak, Sporttherapeut und stellv. Pflegeleitung der BetaGenese Klinik
Wo liegt die Grenze zwischen Disziplin und Sportzwang?
Viele Menschen, die regelmäßig Sport treiben, nehmen sich feste Trainingseinheiten vor. Doch wer unter Sportsucht leidet, kann nicht mehr flexibel auf Pausen oder Erholungstage reagieren. Der Gedanke, eine Einheit ausfallen zu lassen, löst Stress, Unruhe oder Schuldgefühle aus. Das Training wird nicht mehr nur für Fitness oder Leistungssteigerung durchgeführt, sondern um negative Gefühle zu vermeiden.
Ein weiteres alarmierendes Zeichen ist das Ignorieren körperlicher Warnsignale. Trotz Schmerzen oder Verletzungen trainieren Betroffene von Sportsucht weiter – oft mit der Angst, an Fitness zu verlieren oder ohne Sport nicht „funktionieren“ zu können. Dieses Verhalten ähnelt in vielen Aspekten einer Zwangsstörung: Das Training wird zu einem Ritual, das durch aufdringliche Gedanken angetrieben wird und sich einer bewussten Kontrolle entzieht.
Sportsucht behandeln in der BetaGenese Klinik
Sie sind auf der Suche nach einer Privatklinik, um Ihrer Sportsucht den Kampf anzusagen?
Vereinbaren Sie einen Termin und lassen Sie sich beraten.
Sie erreichen uns unter

Sportsucht als Verhaltenssucht: Zwischen Fitness und Fixierung
Der Begriff Sport- oder Bewegungssucht ist zwar schon fast 50 Jahre alt, doch erst in den vergangenen Jahren ist exzessives Sporttreiben mit all seinen negativen Konsequenzen so richtig in den Fokus der Sportwissenschaft gerückt. Mittlerweile gibt es viele Studien und Fallberichte, die darauf hindeuten, dass Sportsucht in mehreren Punkten anderen Verhaltenssüchten ähnelt, wie etwa der Spielsucht, Kaufsucht oder Internetsucht. Die Studien belegen, dass von neun identifizierten Kriterien einer Spielsucht sechs ein Pendant bei der Sportsucht haben.
Symptome von Sportsucht: Diese Alarmzeichen deuten auf einen Fitnesswahn hin
Eine Sportsucht entwickelt sich schleichend. Oft bleibt sie lange unbemerkt, da intensives Training gesellschaftlich akzeptiert oder sogar bewundert wird. Doch wann wird aus gesundem Ehrgeiz ein unkontrollierbarer Zwang? Es gibt klare Warnsignale, die darauf hindeuten, dass Sport nicht mehr nur eine Leidenschaft, sondern eine Abhängigkeit geworden ist. Dazu zählen:
- Übermäßige Zeitinvestition: Ein großer Teil des Tages wird für Sport eingeplant, während andere wichtige Verpflichtungen wie Arbeit, Schule oder soziale Interaktionen vernachlässigt werden.
- Entzugserscheinungen: Trainingspausen führen zu Unruhe, Reizbarkeit, Angst oder depressiven Verstimmungen. Die Betroffenen fühlen sich nur dann ausgeglichen, wenn sie trainieren.
- Toleranzentwicklung: Die Trainingsdauer oder -intensität muss stetig gesteigert werden, um das gleiche Gefühl von Zufriedenheit oder Erfüllung zu erreichen.
- Fortgesetztes Training trotz Verletzungen: Schmerzen, Erschöpfung oder gesundheitliche Beschwerden halten die Betroffenen nicht davon ab, weiterzutrainieren – oft mit langfristigen körperlichen Folgen.
- Soziale Isolation: Sport wird wichtiger als Freunde, Familie oder gemeinsame Aktivitäten. Sozialleben und zwischenmenschliche Beziehungen leiden unter der fixierten Trainingsroutine.
- Übermäßige Sorgen um Körpergewicht- oder form: Ständiger Druck, besser, schlanker oder leistungsfähiger zu sein, kann zu Essstörungen und einem verzerrten Selbstbild führen.
Wer sich in diesen Symptomen wiedererkennt, sollte nicht zögern, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Frühe Anzeichen ernst zu nehmen, ist der erste Schritt auf dem Weg zurück zu einem gesunden Umgang mit Sport.
Ursachen und Risikofaktoren der Sportsucht
Sportsucht entsteht selten über Nacht – oft spielen mehrere Faktoren zusammen. Psychologische Ursachen wie Perfektionismus, hoher Leistungsdruck oder der Wunsch nach Kontrolle können eine entscheidende Rolle spielen. Auch biologische Faktoren, insbesondere die Ausschüttung von Endorphinen und Dopamin während des Trainings, verstärken den Drang, immer weiterzumachen.
Zusätzlich begünstigen gesellschaftliche Einflüsse wie Schönheitsideale, Social Media und das Streben nach Höchstleistungen ein ungesundes Sportverhalten. Besonders gefährdet sind Menschen, die Sport als Bewältigungsstrategie für Stress oder emotionale Probleme nutzen. Wer die eigenen Risikofaktoren erkennt, kann frühzeitig gegensteuern und ein gesundes Verhältnis zum Sport bewahren.
Sportzwang und Essstörungen: Eine bedenkliche Verstrickung
Bis vor wenigen Jahren galt Sportsucht vor allem als Symptom oder Begleiterscheinung von Essstörungen wie Anorexie (Magersucht) oder Bulimie (Ess-Brech-Sucht). „Sehr viele Personen mit einer Essstörung betreiben auch zwanghaft Sport“, weiß Daniel Kosak, Sporttherapeut und stellvertretende Pflegeleitung der BetaGenese Klinik.
Das sei schon viele Jahre bekannt – und könne bisweilen bizarre Formen annehmen. „Wir haben schon magersüchtige Patienten behandelt, die im Unterhemd bei offenem Fenster und Minustemperaturen Liegestütz machen, um noch mehr Fett zu verbrennen.“ Auch viele Bulimiker:innen würden mit panikartiger Angst reagieren, wenn man ihnen nahelegt, nicht sieben Mal die Woche für zwei Stunden joggen zu gehen. „Das ist zwanghaft.“
Der Zusammenhang zwischen Essstörungen und Sportsucht ist mittlerweile gut belegt, wobei Essstörungen in der Regel zur Sportsucht führen. Der Umkehrschluss gilt aber nicht: Bei Weitem nicht jede oder jeder Sportsüchtige hat auch Ernährungsprobleme. Sportsucht kann also eine vollkommen eigenständige Suchterkrankung ist, welche Personen betrifft, die keine Probleme mit ihrem Körperbild oder Gewicht haben. Es ist etwas ganz anderes, ob man exzessiv trainiert, um Gewicht oder Kalorien zu verlieren, oder ob man nur trainiert, um trainiert zu haben respektive um die flüchtigen Glücksgefühle im Training zu erleben.
10 goldene Regeln, mit denen Sie die Balance finden
Ein bewusstes und maßvolles Training ist der Schlüssel zu langfristiger Gesundheit. Wer Sport mit Freude und ohne Zwang betreibt, profitiert körperlich und mental. Doch wie lässt sich vermeiden, dass Bewegung zur Obsession wird?
Mit diesen 10 goldenen Regeln können Sie frühzeitig gegensteuern und ein gesundes Gleichgewicht zwischen Training, Erholung und sozialen Aktivitäten bewahren:
- Variieren Sie Ihr Training, um Überlastung zu vermeiden.
- Hören Sie auf Ihren Körper und passen Sie Ihr Training flexibel an, um Überlastung und Verletzungen zu vermeiden.
- Planen Sie regelmäßige Ruhephasen für die Erholung ein.
- Setzen Sie sich realistische Fitnessziele, um Druck zu vermeiden.
- Achten Sie auf Warnsignale wie anhaltende Müdigkeit oder streben Sie nach Balance zwischen Bewegung, Ruhe und anderen Interessen.
- Holen Sie sich professionelle Hilfe, wenn Sie das Gefühl haben, die Kontrolle zu verlieren.
- Praktizieren Sie Achtsamkeit, um bewusster mit Ihrem Körper umzugehen.
- Suchen Sie soziale Unterstützung von Freunden und Familie, um Ihre Bewegungsgewohnheiten zu reflektieren.
- Erkunden Sie alternative Aktivitäten wie Yoga oder Meditation, um Ihre Fitnessroutine zu ergänzen.
- Setzen Sie klare Grenzen für Ihr Training und halten Sie sich an sie, um Übertraining zu vermeiden.
Psychische Folgen der Sportsucht
Sportsucht betrifft nicht nur den Körper, sondern kann auch erhebliche psychische Belastungen mit sich bringen. Betroffene geraten in einen Teufelskreis aus Druck, Zwang und Angst, der ihr Wohlbefinden stark beeinträchtigt.
- Emotionale Abhängigkeit:
Ohne Training fühlen sich Betroffene unruhig, gereizt oder sogar depressiv. Das Training wird zur einzigen Möglichkeit, sich gut zu fühlen.
- Angst und Schuldgefühle:
Schon der Gedanke, eine Einheit ausfallen zu lassen, löst Stress oder Schuldgefühle aus.
- Soziale Isolation:
Freundschaften, Familie und andere Hobbys werden vernachlässigt, weil der Sport immer an erster Stelle steht.
- Perfektionismus und Selbstzweifel:
Ein ständiger innerer Druck, besser zu sein, führt zu einem verzerrten Selbstbild und kann das Selbstwertgefühl mindern.
- Erhöhtes Risiko für weitere psychische Erkrankungen:
Sportsucht tritt häufig zusammen mit Essstörungen, Angststörungen oder Depressionen auf.
Hilfe für Sportsüchtige in der BetaGenese Klinik
Entdecken Sie unsere spezialisierte Therapie zur Behandlung von Sportsucht. Unsere Verhaltenstherapie, insbesondere die kognitive Verhaltenstherapie, hilft Ihnen, die Gründe hinter Ihrem Zwang zu verstehen und neue, gesündere Verhaltensweisen zu entwickeln.
Süchtig nach Sport? Ihr Weg zurück zu einem gesunden Gleichgewicht
Sportsucht kann Körper und Geist stark belasten –der erste Schritt zur Veränderung beginnt mit der richtigen Unterstützung. In der BetaGenese Klinik setzen wir auf gezielte kognitive Verhaltenstherapie und individuelle Behandlungsansätze, um die tieferliegenden Ursachen der Sportsucht zu erkennen und nachhaltig gesündere Verhaltensmuster zu entwickeln.
✔ Individuelle Therapie für einen bewussten Umgang mit Sport
✔ Ganzheitlicher Behandlungsansatz mit psychotherapeutischer und medizinischer Begleitung
✔ Nachhaltige Strategien zur Rückgewinnung der Kontrolle über Ihr Training
Lernen Sie, Sport wieder als Teil eines ausgeglichenen Lebens zu genießen – ohne Zwang, ohne Druck.
Vereinbaren Sie noch heute einen Termin in der BetaGenese Klinik:
Telefon: +49 228 / 90 90 75 – 500
Ihre Vorteile in der BetaGenese Klinik: Privatklinik für interdisziplinäre Psychosomatik und Psychiatrie
➤ Medizinische Rundum-Versorgung unter einem Dach
➤ Exzellent ausgebildeten Fachärzten, Psychologen und Therapeuten
➤ Breites Spektrum psychosomatischer Beschwerden
➤ Moderne diagnostische Verfahren direkt vor Ort
➤ Ganzheitliche psychosomatische Behandlung in Kooperation mit der Beta Klinik
➤ Multimodales Behandlungskonzept, das untersch. Therapieansätze vereint
➤ Komfortables, attraktives Ambiente am Rheinufer
➤ Kurzfristige Terminvergabe
Ihre Gesundheit – Unsere Kompetenz.