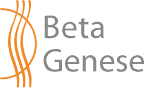Vom Vergnügen zur Last: Die subtile Suchtgefahr
Abseits der gängigen Klischees von verwahrlosten Gestalten auf Parkbänken ist die Realität der Alkoholabhängigkeit viel komplexer und vielschichtiger. Nicht selten beginnt sie in einem Augenblick des Genusses und entwickelt sich schleichend zur Gewohnheit. Versteckte Flaschen im Schrank, verpasste Absprachen – die Anzeichen für ein sich ausweitendes Problem mehren sich. Spätestens wenn der Alltag ohne Alkohol nicht mehr bewältigt werden kann oder wenn der Alkoholmissbrauch Schädigungen verursacht – sei es körperlich, seelisch oder sozial ist der Konsum zu einer ernstzunehmenden Gefahr geworden.

Jetzt Beratungsgespräch vereinbaren
Bei uns erhalten Sie schnelle Hilfe bei Alkoholsucht.
Melden Sie sich bei uns:
Inhaltsverzeichnis
- Alkoholkonsum in Deutschland: Millionen über Grenzwert
- Suchtverhalten: Warum Kontrolle so schwer ist
- Die 4 Phasen der Alkoholsucht
- Auswirkungen und Folgen von Alkoholsucht
- Alkoholsucht erkennen
- Symptome von Alkoholabhängigkeit
- Therapie und Hilfe bei Alkoholsucht
- Alkoholsucht überwinden: Schritt für Schritt
Alkoholsucht: Das Wichtigste in Kürze
- Alkoholsucht betrifft Millionen Menschen – Oft unbemerkt, beginnt eine Alkoholabhängigkeit als gelegentlicher Genuss und kann zu einem zentralen Bestandteil des Lebens werden.
- Gesundheitsrisiken: Alkoholsucht führt zu schwerwiegenden physischen und psychischen Erkrankungen, darunter Leberzirrhose, Krebs und psychische Störungen wie Depressionen. Bereits mäßiger Konsum kann langfristige Schäden verursachen.
- Es gibt 4 Phasen der Alkoholsucht:
- Voralkoholisch: Alkohol zur Stressbewältigung
- Anfangsphase: Heimlicher Konsum, Schuldgefühle
- Kritische Phase: Kontrollverlust, Konflikte
- Chronische Phase: Alkohol dominiert das Leben, gesundheitliche Schäden
- Hilfe und Therapie: Alkoholsucht ist behandelbar. In der BetaGenese Klinik bieten wir eine umfassende, individuelle Therapie, die körperliche Entgiftung und psychologische Unterstützung kombiniert. Wir begleiten Sie auf dem Weg zu einem selbstbestimmten Leben.
Alkoholkonsum in Deutschland: Millionen über Grenzwert
Geschätzt 2,5 Millionen Deutsche trinken mehr als eine sogenannte risikoarme Menge. Risikofrei ist der Alkoholkonsum nie, er geht immer mit Gefahren einher. Von einem schädlichen Gebrauch sprechen Fachleute, wenn Menschen regelmäßig zu viel trinken und dabei körperliche oder psychische Schäden durch den Alkoholkonsum in Kauf nehmen.
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) definiert eine risikoarme Menge des Zellgifts Alkohol wie folgt: Bei Männern sind es maximal 24 Gramm Reinalkohol am Tag – das entspricht etwa zwei Gläsern Bier je 0,3 Liter – an höchstens fünf Tagen in der Woche. Bei Frauen liegt der Wert bei nur 12 Gramm Reinalkohol. Da ihr Flüssigkeitsgehalt im Körper niedriger ist als bei Männern, führt die gleiche Menge Alkohol bei Frauen zu einer höheren Alkoholkonzentration im Blut. Jedoch ist selbst ein moderater Konsum mit gesundheitlichen Risiken verbunden, insbesondere für bestimmte Gruppen wie Jugendliche, Schwangere und Menschen mit Vorerkrankungen.
Der Alkoholkonsum in Deutschland stellt weiterhin eine erhebliche gesundheitliche Herausforderung dar. Jüngste Daten des Deutschen Zentrums für Suchtfragen (DHS) zur Alkoholsucht zeigen, dass 7,9 Millionen Menschen der 18- bis 64-jährigen Bevölkerung in Deutschland regelmäßig mehr Alkohol konsumiert als von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfohlen.
Ein schädlicher Alkoholkonsum liegt vor, wenn der Konsum zu körperlichen, psychischen oder sozialen Problemen führt. Dieser Prozess ist oft schleichend und kann unbemerkt bleiben, bis schwerwiegende Folgen eintreten.
Aktuelle Studien, wie die des Deutschen Krebsforschungszentrums zu Risikofaktoren von Alkoholsucht, unterstreichen zudem den Zusammenhang zwischen Alkoholkonsum und einem erhöhten Risiko für verschiedene Erkrankungen, darunter:
- Leberzirrhose
- bestimmte Krebsarten
- psychische Störungen
Es ist wichtig zu betonen, dass jeder Mensch eine individuelle Reaktion auf Alkohol zeigt und die Toleranz im Laufe der Zeit abnehmen kann.
Suchtverhalten: Warum Kontrolle für manche schwerer ist
Carsten Albrecht, Chefarzt der BetaGenese Klinik, beschreibt Alkoholsucht als Methode der Gefühlsregulation:

„Für viele Betroffene von Alkoholsucht ist der Konsum eine Methode zur Gefühlsregulation. Viele Menschen, die an einer Alkoholsucht erkranken, trinken ja, weil sie Gefühle, Gedanken oder Sorgen haben, die sie nicht aushalten können und weniger, weil sie es so toll finden, betrunken zu sein. Da wird viel eher getrunken, um Unerträgliches zu vermeiden. Menschen mit Alkoholabhängigkeit trinken nicht zwingend in Gesellschaft oder weil es so schön ist im Biergarten, sondern eher allein. Das trifft natürlich nicht auf alle zu. Wenn Sie sich also regelmäßig in großer Runde die Kante geben, heißt das nicht, dass Sie davor geschützt sind, an Alkoholsucht zu erkranken. Wichtig ist, zu verstehen, dass es nicht darum geht, dass man es sich besonders gut gehen lässt, sondern dass es bei einer Alkoholsucht häufig einfach darum geht, dass es einem weniger schlecht geht.“
Wir sind für Sie da: Bei uns erhalten Betroffene schnelle Hilfe bei Alkoholsucht

Alkoholsucht ist eine Belastung, die niemand allein tragen muss. In der BetaGenese Klinik erhalten Sie diskrete und professionelle Unterstützung auf Ihrem Weg zu einem selbstbestimmten Leben.
Rufen Sie uns an: +49 228 / 90 90 75 – 500
Oder schreiben Sie uns eine Nachricht
Die 4 Phasen der Alkoholsucht: Symptome, Anzeichen und Warnsignale erkennen und handeln
Eine Alkoholabhängigkeit entwickelt sich meist schleichend und bleibt oft lange unbemerkt. Um die Sucht nach Alkohol zu verstehen und erste Schritte zur Bewältigung zu gehen, ist es wichtig, die verschiedenen Phasen zu kennen:
- Voralkoholische Phase
Der Alkoholkonsum beginnt meist als Mittel zur Stressbewältigung oder um negative Emotionen wie Angst oder Traurigkeit zu dämpfen. Mit der Zeit steigt die Toleranz – es wird immer mehr Alkohol benötigt, um dieselbe Wirkung zu erzielen. - Anfangsphase
In dieser Phase wird Alkohol zunehmend heimlich konsumiert. Erste Schuldgefühle stellen sich ein, und es fällt schwer, die Kontrolle über Menge und Häufigkeit des Trinkens zu behalten. - Kritische Phase
Die Kontrolle über den Konsum geht immer mehr verloren. Konflikte in der Familie, am Arbeitsplatz oder im sozialen Umfeld nehmen zu. Häufig scheitern Betroffene an Abstinenzversuchen, was das Gefühl der Hilflosigkeit verstärkt. - Chronische Phase
Der Alkohol dominiert das Leben. Gesundheit und soziale Kontakte werden zunehmend vernachlässigt. Körperliche Folgen wie Leberschäden, Kreislaufprobleme oder Nervenschäden treten auf, begleitet von mentalen Beeinträchtigungen wie Depressionen oder Angststörungen.
Auswirkungen und Folgen von Alkoholsucht: Die unterschätzten Gefahren
Alkohol mag anfangs entspannend wirken, doch bereits bei mäßigem Konsum können gesundheitliche Schäden entstehen. Wussten Sie, dass täglich etwa 200 Menschen in Deutschland an den Folgen des Alkohols sterben? Alkohol beeinträchtigt nicht nur die körperliche Gesundheit, sondern verändert auch die Gehirnfunktion.
Akute Wirkungen: Alkohol im Körper
- Ab 0,3 Promille: Leichte Euphorie und Entspannung
- Ab 0,5 Promille: Eingeschränktes Wahrnehmungs- und Reaktionsvermögen
- Ab 0,8 Promille: Koordinationsprobleme und erhöhtes Unfallrisiko
- Ab 1,0 Promille: Starke Beeinträchtigung der Kommunikation und Entscheidungsfähigkeit
Langfristige Folgen von Alkohol
Langjähriger Alkoholkonsum kann über 200 verschiedene Krankheiten verursachen, darunter:
- Lebererkrankungen wie Fettleber oder Leberzirrhose
- Herz-Kreislauf-Probleme und Nervenschäden
- Krebsarten wie Leber-, Mund-, oder Speiseröhrenkrebs
- Psychische Erkrankungen wie Depressionen oder Angststörungen.
Psychische Folgen von Alkoholismus umfassen häufig Persönlichkeitsveränderungen, Depressionen, Angststörungen und Gedächtnisprobleme. Die gesellschaftlichen und rechtlichen Konsequenzen sind beträchtlich: Alkoholkonsum verursacht jährlich einen wirtschaftlichen Schaden von fast 57 Milliarden Euro, durch Verkehrsunfälle, Straftaten und Produktivitätsverluste. Schon kleine Mengen Alkohol beeinträchtigen die Koordination und führen zu Unfällen, während alkoholbedingte Straftaten und Arbeitsunfälle weit verbreitet sind.
Darüber hinaus schädigt Alkohol die DNA und beeinträchtigt die Aufnahme von Nährstoffen. Besonders während der Schwangerschaft kann Alkoholkonsum deshalb zu schwerwiegenden gesundheitlichen Schäden beim ungeborenen Kind führen und das schon in sehr geringen Mengen.
Alkoholsucht erkennen: Die wichtigsten Anzeichen und Warnsignale
Alkoholabhängigkeit entwickelt sich oft unbemerkt – ein schleichender Prozess, der sich über Jahre hinweg aufbauen kann. Für viele Betroffene ist es schwer, den eigenen Konsum kritisch zu hinterfragen, da das Trinken häufig als harmlos oder gesellschaftlich akzeptiert wahrgenommen wird. Doch genau diese Verharmlosung und das Leugnen der Problematik machen es umso schwieriger, die Abhängigkeit frühzeitig zu erkennen.
Warum ist das so?
Alkohol wird oft genutzt, um schwierige Gefühle zu unterdrücken oder belastende Situationen und Erlebnisse scheinbar leichter zu bewältigen. Gedanken wie „Es hilft mir, den Tag zu überstehen“ oder „Ein Glas beruhigt mich nach der Arbeit“ können schnell zur Gewohnheit werden. Expertinnen und Experten weisen darauf hin, dass regelmäßiger Alkoholkonsum als Bewältigungsstrategie ein klares Warnsignal für Abhängigkeit sein kann.
Typische Anzeichen einer Alkoholsucht sind:
- Ein ständiges Verlangen nach Alkohol, auch außerhalb von gesellschaftlichen Anlässen.
- Schwierigkeiten, ohne Alkohol zu entspannen oder einzuschlafen.
- Schuldgefühle oder Konflikte im sozialen Umfeld aufgrund des Trinkverhaltens.
- Körperliche Entzugserscheinungen wie Zittern oder Schwitzen.
Unterstützung bei Alkoholabhängigkeit und Depressionen

Alkoholsucht und Depressionen gehen oft Hand in Hand – und beide sind behandelbar. In der BetaGenese Klinik bieten wir spezialisierte Therapien, die auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt sind. Unser Team unterstützt Sie dabei, nicht nur die Sucht zu überwinden, sondern auch seelisches Gleichgewicht zurückzugewinnen.
Symptome Alkoholabhängigkeit gemäß ICD-10
Die Diagnose einer Alkoholabhängigkeit basiert auf klar definierten Kriterien, die im internationalen Klassifikationssystem ICD-10 (Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme) festgelegt sind. Laut diesen Richtlinien liegt eine Abhängigkeit vor, wenn innerhalb der letzten zwölf Monate mindestens drei der folgenden Merkmale gleichzeitig auftreten:
- Starkes Verlangen (Craving): Ein anhaltendes oder wiederkehrendes Verlangen nach Alkohol, das kaum kontrollierbar ist.
- Kontrollverlust: Schwierigkeiten, die Menge oder den Zeitpunkt des Trinkens zu steuern, z. B. häufigerer Konsum als geplant.
- Entzugserscheinungen: körperliche Symptome wie Zittern, Schwitzen, Unruhe, Schlafstörungen oder Kreislaufprobleme bei Nichterfüllung des Verlangens.
- Toleranzentwicklung: Um die gleiche Wirkung zu erzielen, wird zunehmend mehr Alkohol benötigt.
- Vernachlässigung anderer Interessen: Aktivitäten und soziale Kontakte werden vernachlässigt, da Alkoholbeschaffung und -konsum Vorrang gegeben wird.
- Trinken trotz schädlicher Folgen: Der Konsum wird fortgesetzt, obwohl körperliche oder psychische Schäden wie Leberschäden oder Depressionen bekannt sind.
Therapie und Hilfe bei Alkoholabhängigkeit
Ihre ersten Schritte: Hilfe suchen
Der Weg aus der Alkoholabhängigkeit erfordert Mut, doch Sie müssen ihn nicht allein gehen. Viele Betroffene berichten, dass es hilfreich ist, offen über ihren problematischen Alkoholkonsum zu sprechen. Ein erster Ansprechpartner bzw. eine erste Ansprechpartnerin kann Ihr Hausarzt oder Ihre Hausärztin sein, die Ihnen mit Verständnis und Diskretion zur Seite stehen.
Diagnose und erste Schritte
- Ihr Arzt oder Ihre Ärztin wird in einem vertrauensvollen Gespräch Ihre Bedenken erörtern und Fragen zu Ihrem Trinkverhalten stellen.
- Eine körperliche Untersuchung kann Aufschluss darüber geben, ob der Alkoholkonsum bereits gesundheitliche Schäden, wie zum Beispiel Leberschäden, verursacht hat. Ein erhöhter Wert des Enzyms Gamma-GT im Blut ist oft ein Hinweis darauf.
- Die Wahl der richtigen Therapie hängt von der Schwere der Abhängigkeit und möglichen Folgeschäden ab. Ihr Arzt oder Ihre Ärztin wird Sie bei Bedarf an eine ambulante oder stationäre Suchthilfeeinrichtung überweisen, wo Sie spezialisierte Unterstützung erhalten.
Alkoholismus überwinden: Schritt für Schritt
Alkoholismus ist behandelbar. Ärztliche und psychologische Unterstützung sind entscheidend auf dem Weg zur Abstinenz. Ein kalter Entzug kann lebensbedrohlich sein und erfordert ärztliche Überwachung.
Alkoholentzug und seine Risiken: Der Entzug führt zu übermäßiger Reizung des Nervensystems, begleitet von Symptomen wie Zittern, Schwitzen und erhöhtem Blutdruck. Schwere Fälle können zu Anfällen oder Delirium tremens führen, die tödlich enden können, wenn sie nicht unter medizinischer Aufsicht erfolgen.
Körperliche Entgiftung: Die stationäre Behandlung in Fachkliniken ist üblich. Medikamente wie Clomethiazol werden verschrieben, um Entzugssymptome zu lindern. Die Entgiftung dauert in der Regel ein bis zwei Wochen.
Qualifizierte Behandlung: Nach dem Entzug folgt eine intensive Therapie, die die Wahrscheinlichkeit einer dauerhaften Abstinenz erhöht. Individuelle Pläne und psychotherapeutische Sitzungen spielen eine zentrale Rolle.
Entwöhnungsbehandlung: Eine nahtlose Fortsetzung der Behandlung ist wichtig. Die Entwöhnungsphase dauert in der Regel zwischen acht und zwölf Wochen und kann stationär oder ambulant erfolgen. Es werden Strategien entwickelt, um mit Risikosituationen umzugehen und Rückfälle zu verhindern. Familienmitglieder können auch Unterstützung erhalten.
Therapie bei Alkoholsucht: Warum professionelle Hilfe wichtig ist
Ein kalter Entzug kann gefährlich sein und lebensbedrohliche Komplikationen wie Krampfanfälle oder Delirium tremens hervorrufen. Fachkliniken bieten medizinisch überwachte Entgiftungen, bei denen die Symptome gezielt behandelt werden.
Nach der körperlichen Entgiftung folgt die Entwöhnungstherapie, die sich auf die psychische und soziale Stabilisierung konzentriert. Hier entwickeln Sie Strategien, um Rückfälle zu vermeiden, und stärken Ihre Fähigkeit, ein Leben ohne Alkohol zu führen.
In der BetaGenese Klinik für Psychosomatik in Bonn streben wir danach, die Alkoholsucht nicht nur als isoliertes Phänomen zu betrachten, sondern als Teil eines komplexen Geflechts von biologischen, psychologischen und sozialen Faktoren.
Unser Ziel ist es, die individuelle Wiederherstellung von Gesundheit, Würde und Lebensqualität zu fördern. Wir glauben an die Stärke jedes und jeder Einzelnen und sind fest davon überzeugt, dass der Weg zur Genesung mit Unterstützung, Verständnis und professioneller Hilfe beschritten werden kann.
- Medizinische Rundum-Versorgung unter einem Dach
- Exzellent ausgebildete Fachärzte, Psychologen und Therapeuten
- Breites Behandlungsspektrum psychosomatischer Beschwerden
- Moderne diagnostische Verfahren direkt vor Ort
- Ganzheitliche psychosomatische Behandlung in Kooperation mit der Beta Klinik
- Multimodales Behandlungskonzept, das unterschiedliche Therapieansätze vereint
- Komfortables, attraktives Ambiente am Rheinufer
- Kurzfristige Terminvergabe
Ihre Gesundheit – Unsere Kompetenz.